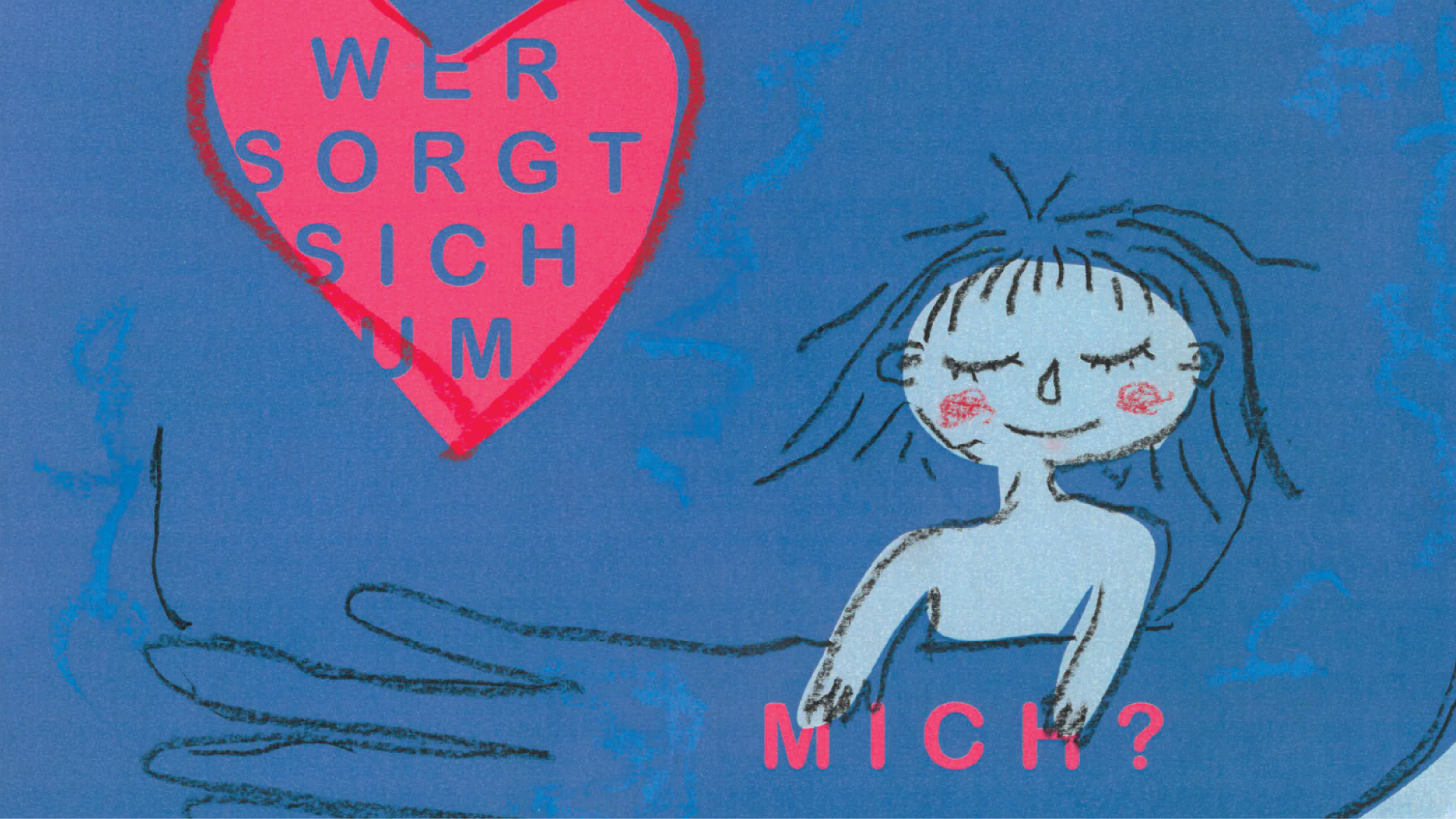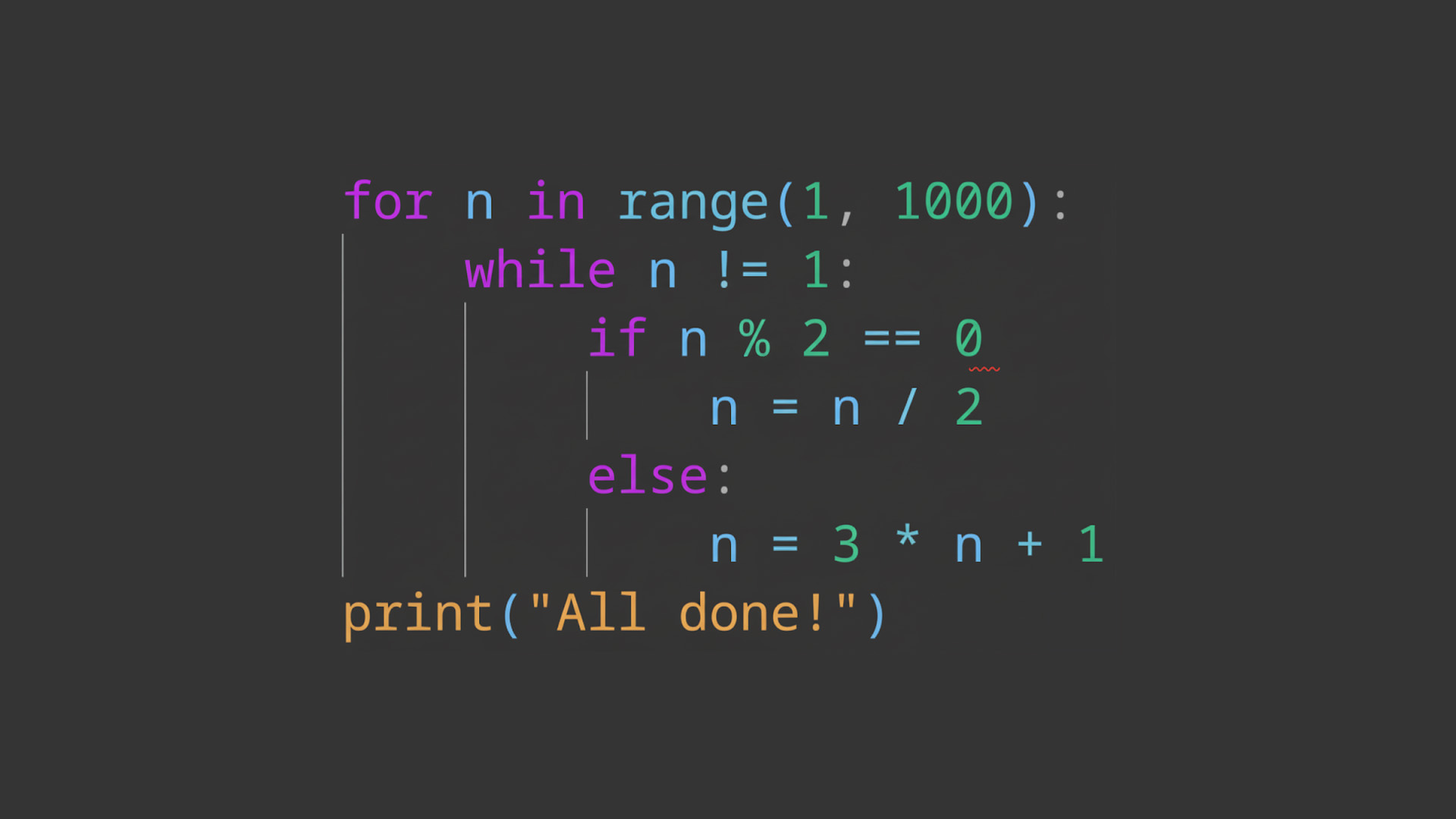Lieblingswort aus dem Sindarin von Jasper Hase, Schüler, G4
«Mithrandir»
Es mag ein wenig nerdig sein, doch ich bin ein grosser Fan von Fantasy- und Science-Fiction-Geschichten. Dieses Interesse wurde schon früh geweckt, als ich mit etwa 13 Jahren den «Hobbit» von J. R. R. Tolkien gelesen habe und anschliessend die Filme schauen durfte. Seither ist das Wort fest in meinem Kopf verankert, und ich verbinde mit ihm viele schöne Erinnerungen an das erste Lesen von Fantasiegeschichten und das Basteln imaginärer Fantasiewelten. Das Wort «Mithrandir», welches aus der Sprache der Elben stammt, genauer dem «Sindarin», bedeutet so viel wie «Grauer Pilger» oder «Grauer Wanderer». Es ist ein alter Name des Zauberers Gandalf, den die Elbin Galadriel beispielsweise noch benutzt.
Vor einiger Zeit ist mir dieser Name wieder in den Sinn gekommen, und ich fing zuerst an, etwas Sindarin zu lernen und mich dann grundsätzlich mit dem System der Sprachen, welche Tolkien für seine Werke entwickelt hat, zu befassen. Es handelt sich nämlich nicht um zufällige Lautkombinationen, sondern um eine Sprache mit Grammatik und einem ausgeklügelten Lautsystem.
Neben der persönlichen Bedeutung, die der Begriff «Mithrandir» hat, finde ich den Klang sehr schön. Dies ist mit Sicherheit ein weiterer Grund, weshalb mich das Wort stets begleitet und von Neuem fasziniert.
Lieblingsausdruck aus dem Chinesischen von Nathalie Bao-Götsch, Lehrperson Chinesisch
«看不懂 kànbudǒng»
Wenn man sich seit mehr als dreissig Jahren intensiv mit einer Fremdsprache beschäftigt und sie jungen Menschen vermittelt, wächst allmählich und fast unbemerkt eine Sammlung an Lieblingswörtern heran. Ein einziges daraus auszuwählen ist schwierig, denn auch nach so vielen Jahren begeistert mich die Vielfalt der chinesischen Sprache und Schrift immer wieder von Neuem.
Nach langem Überlegen habe ich mich schliesslich für «看不懂 kànbudǒng» entschieden. Es ist weder besonders schön noch poetisch oder originell, sondern zunächst einmal ganz einfach einer der häufigsten Ausdrücke, den ich als Studentin in China anfangs benutzte. Da er im Vergleich zu vielen andere Wörtern auch recht einfach auszusprechen ist, wurde ich stets verstanden – was bei einer Tonsprache wie Chinesisch keineswegs selbstverständlich ist! Der Ausdruck eignet sich aber vor allem sehr gut, um zu veranschaulichen, was diese Sprache und Schrift so faszinierend macht.
Im Chinesischen lassen sich mit sehr wenigen Silben prägnante Aussagen machen oder Sachverhalte umschreiben, für die im Deutschen oder in anderen Sprachen weitaus mehr Wörter nötig wären. Dafür gibt es mehrere Gründe: Chinesische Vokabeln bestehen aus einer Silbe oder maximal zwei bis drei Silben, die zudem sehr kurz sind. Für europäische Fremdsprachenlernende ist es meist überraschend, dass Chinesisch keine Flexion kennt, also keine Wortformen. Die syntaktische Funktion eines Wortes ergibt sich aus seiner Position im Satz. Dadurch können Lernende vergleichsweise schnell ganze Sätze bilden, sofern sie die Vokabeln beherrschen und korrekt aussprechen. Chinesisch ist ausserdem eine Kontextsprache. Was aus dem Zusammenhang klar ist, muss nicht explizit ausgedrückt oder kann sogar weggelassen werden. In gewisser Weise ist es also eine sehr ökonomische Sprache. Und schliesslich wird Chinesisch mit einem Schriftsystem geschrieben, bei dem jedes schriftliche Zeichen in der Regel semantische Informationen trägt.
Mein gewählter Ausdruck besteht aus dem Verb 看 kàn («schauen» oder «lesen»), und wird durch ein zweites Verb, 懂dǒng («verstehen») ergänzt. Solche Verbergänzungen sind typisch für die chinesische Grammatik. Das zweite Verb zeigt hier das Resultat der ersten Handlung an. Wenn man zwischen diese beiden Verben eine Partikel oder – wie in unserem Beispiel – das Verneinungsadverb 不 bù («nicht», in seiner unbetonten Variante bu) stellt, entsteht die Möglichkeitsform bzw. ihre Negation. «看不懂 kànbudǒng» bedeutet also, dass jemand etwas anschaut oder liest, aber nicht in der Lage ist, es zu verstehen. Auf Deutsch würde man dies mit «nicht verstehen können» oder «nicht lesen können» übersetzen. Für die korrekte Verwendung im Deutschen müssten aber noch ein passendes Subjekt ausgewählt, ein Objekt bzw. «es» eingefügt, das Verb konjugiert und die Wortstellung angepasst werden.
Die Informationen, die in den Schriftzeichen stecken, lassen sich hingegen nicht in den deutschen Ausdruck übertragen: Das Schriftzeichen für 看kàn setzt sich aus den semantischen Komponenten 手«Hand» und 目 «Auge» zusammen – als ob man mit der Hand über den Augen etwas betrachtet oder liest. Das Zeichen für 懂dǒng besteht aus einer semantischen Komponente 忄(«Herz» verkürzte Form von 心) und einer phonetischen Komponente. Die Herz-Kompononente findet sich auch in vielen anderen Schriftzeichen, die mit Emotionen zu tun haben. Solche Bestandteile zu erkennen, ist sehr wichtig, um sich Schriftzeichen einprägen zu können und macht das Lernen abwechslungsreich. Natürlich wird «看不懂 kànbudǒng» aber meist mündlich verwendet, – schliesslich drückt es ja aus, dass man etwas (noch) nicht lesen kann.

Lieblingswort aus dem Englischen von Smilla Wieders, Berufslernende
«Trust»
Ein Wort, das mehr aussagt, als man vielleicht auf den ersten Blick erkennt. Es steht für den Mut, sich selbst und anderen zu vertrauen – in Momenten der Unsicherheit wie im Augenblick des Erfolgs. Vertrauen ist keine blindlings erfolgende Handlung, sondern eine bewusste Entscheidung, die Beziehungen vertieft und Zukunft ermöglicht. Ich habe mich bewusst für das englische Wort «Trust» entschieden, da es sich für mich unmittelbarer anfühlt als der deutsche Begriff und Offenheit ausstrahlt. Vertrauen macht uns angreifbar, denn es birgt immer die Möglichkeit von Enttäuschung oder Missbrauch. Umso kostbarer ist echtes Vertrauen – weil es trotz des Risikos bewusst geschenkt wird.